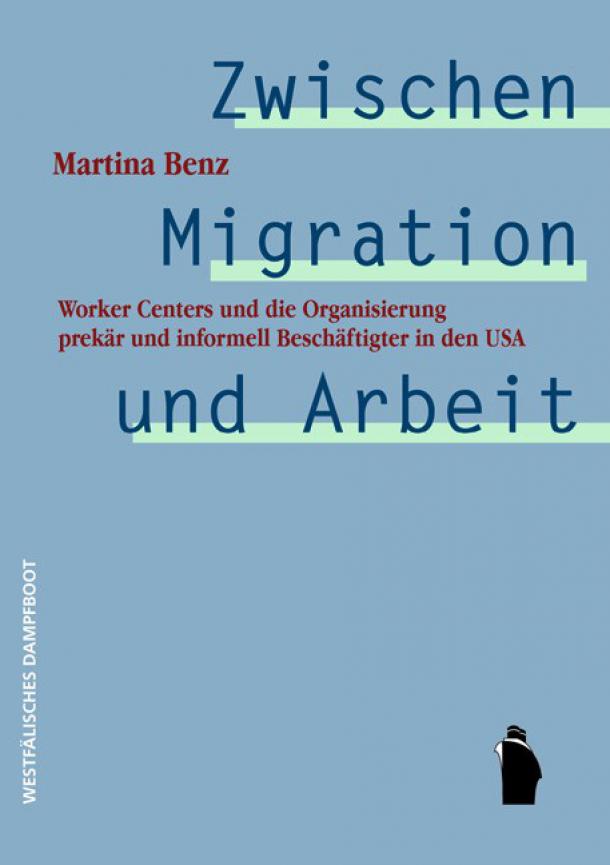Über den Betrieb hinaus
Rezension zu Martina Benz: "Zwischen Migration und Arbeit - Worker Centers und die Organisierung prekär und informell Beschäftigter in den USA"
Die Idee von „Worker Centers“ ist, etwas zeitverzögert, gemeinsam mit den Konzepten US-amerikanischer Gewerkschaften zu „Organizing“ und „Campaining“ über den großen Ozean geschwappt. „Worker Centers“ scheinen überall dort eine attraktive Idee zu sein, wo die gewerkschaftliche Organisierung problematisch wird – allgemein in prekären Beschäftigungsbereichen und hier vor allem noch einmal dort, wo insbesondere migrantische Arbeiter*innen beschäftigt werden.
Martina Benz hat nun mit ihrer im Verlag Westfälisches Dampfboot erschienenen Dissertation „Zwischen Migration und Arbeit. Worker Centers und die Organisierung prekär und informell Beschäftigter in den USA“ eine Studie zu den Funktions- und Arbeitsweisen dieser Worker Centers vorgelegt. Dabei stellt sie Fallbeispiele aus drei verschiedenen Organisierungsbereichen dar: Die Organisierung von Gastronomie- und Einzelhandels-Arbeiter*innen in New York City, die Organisierung von Hausangestellten, ebenfalls in New York sowie die Organisierung von – fast ausschließlich männlichen - Tagelöhnern in Kalifornien. So unterschiedlich die beschriebenen Organisierungsbereiche sind, so unterschiedlich sind auch die Kampagnen, mit denen sie einhergehen, von Kampagnen gegen Lohnraub über die Anerkennung der Arbeit als Lohnarbeit bis hin zu dem Recht, seine Arbeit auf einem unregulierten Arbeitsmarkt überhaupt zu verkaufen.
Diese recht unterschiedlichen Beispiele illustrieren bereits, wo Chancen und Risiken von Worker Centers liegen: Einerseits entstehen sie überall dort, wo Gewerkschaften aus verschiedenen Gründen kaum handlungsfähig sind und sind eine realistische Option, die angeblich „Unorganisierbaren“ zu organisieren. Das liegt letztlich eben weniger daran, dass sie tatsächlich „unorganisierbar“ seien, sondern vielmehr an dem spezifischen US-amerikanischen Gewerkschaftssystem. Eine Gewerkschaft muss ihren Vertretungsanspruch durch Anerkennungswahlen im Betrieb belegen, um überhaupt als solche tätig werden zu können. Wo dies nicht gegeben ist – weil Anerkennungswahlen nicht möglich sind, nicht gewonnen werden können oder die gewerkschaftliche Unterstützung gleich ganz fehlt – übernehmen Worker Centers die Aufgaben, die uns als spezifisch gewerkschaftlich erscheinen mögen.
Organisatorische Vielfalt
Die verschiedenen beschriebenen Arbeitsverhältnisse machen aber auch deutlich, wie unterschiedlich prekäre Beschäftigung organisiert sein kann und wie differenziert daher die Strategien der unterschiedlichen Worker Centers ausfallen. Benz differenziert einen Aktivismus, der eigentlich dem von Gewerkschaften entspricht – nicht ganz unpassend subsumiert Vanessa Tait sie unter „poor workers’ unions“ (S.216) – einem ähnlichen Aktivismus zu NGOs (Nichtregierungsorganisationen) sowie dem Repertoire neuer sozialer Bewegungen. Dabei verdeutlicht sie, dass keine dieser Organisationsarten in reiner Form auftaucht, vielmehr tendieren die Worker Centers, je nach Arbeitsschwerpunkt, in die eine oder andere Richtung. Deutlich wird in jedem Fall: Aufgrund der verschiedenen Bedingungen müssen sich Worker Center für einen Schwerpunkt und für eine Strategie entscheiden. So schildert Benz anhand der Organisierung der New Yorker Gastronomie-Arbeiter*innen einen Konflikt, der in direkten Verhandlungen mit den Unternehmen sicherlich durch eine Gewerkschaft ähnlich gelöst worden wäre; die Hausangestellten dagegen agierten, durchaus auch gemeinsam mit den Auftraggebern, für die sie arbeiten, auf moralischer und politischer Ebene, indem sie dafür kämpften, dass ihre Reproduktionsarbeit unter die rechtlichen Rahmenbedingungen für Lohnarbeit falle; die Kämpfe der Tagelöhner dagegen haben eine juristische Prägung.
Ein weiterer Aspekt macht das Organisieren prekär Beschäftigter kompliziert und mahnt dazu, sich auf ein Gebiet zu konzentrieren: Die Sprachproblematik, die in Deutschland noch wesentlich ausgeprägter wäre, als in den USA, wo die zwei Sprachen Englisch und Spanisch sicherlich in vielen Bereichen für ein Organizing schon ausreichend sind. Benz nennt allerdings gerade für den Bereich der häuslichen Arbeit auch die Vielzahl asiatischer Arbeitskräfte, für die dies nicht in jedem Fall gelten wird.
Die Sprachproblematik weist aber auch auf eine Gemeinsamkeit in der Arbeit der Worker Centers hin: Die berufliche Bildung, zu der auch Sprachkurse gehören, ist als Einstieg in das Engagement für die eigenen Interessen nicht zu unterschätzen. Die spezifische, berufliche Qualifikation ist für die Worker Centers, oft auch gefördert durch die Unternehmerseite bzw. durch von diesen finanzierte Stiftungen, einerseits finanzielle Grundlage, aber ebenso der Einstieg in die Selbstorganisation, indem die berufliche Bildung politisch gerahmt wird: „Entgegen der neoliberalen Vision von Empowerment wird in den Worker Centers gerade die gesellschaftliche und politische Dimension individueller Probleme vermittelt“ (S.211). Das ist, wie Benz ausführlich schildert, nicht immer widerspruchsfrei. Die Abhängigkeit von externer Finanzierung kann die Worker Centers auch in inhaltliche Abhängigkeit bringen – und brachte sie 2007/2008 mit Beginn der Weltwirtschaftskrise auch anderweitig in Bedrängnis, gerade als sie nötiger als zuvor gebraucht wurden. Dadurch wie auch durch ihre spezifische Geschichte geraten die Worker Centers in eine gewisse Ambivalenz: Einerseits organisieren sie, wie der Neoliberalismus es vorsieht, ehemals kollektiv, staatlich oder von Unternehmerseite aus garantierte Sozialleistungen, Bildungskompetenzen und berufliche Grundlagen auf einer letztlich privaten Basis, andererseits organisieren sie kollektiv den Widerstand gegen eben diese neoliberalen Zumutungen. Martina Benz merkt diese Ambivalenz zurecht, dabei auf David Harvey rekurrierend, an – aber letztlich gilt sie heute für fast alle sozialen Bewegungen, NGOs und auch Gewerkschaften, unter den momentanen Bedingungen ist dieser Widerspruch nicht auflösbar.
Machtressourcen und Organisationsstrukturen
In zweierlei Weise möchte Benz sich von bisherigen Forschungsarbeiten zu Worker Centers abgrenzen: Erstens betont sie, dass es sich bei den Worker Centers um Selbstorganisationen handelt, und nicht um Stellvertreter-(„advocacy“)-Organisationen. Und zweitens betont sie die Worker Centers als eigenständige Machtressource, die gegenüber der Organisierung in Gewerkschaften Vorteile hätte.
Beide Aspekte sind m.E., gerade durch Martina Benz eigene Forschungsarbeit, lange nicht so eindeutig, wie die Autorin abschließend darstellt. So betont sie (S.217) einerseits, dass Worker Centers „nicht in der Lage sind, Macht zu generieren“, sondern diese entstände, wie sie im Anschluss an Piven und Cloward formuliert, „in sozialen Kämpfen, die außerhalb der Worker Center stattfinden“. Noch auf derselben Seite konstatiert sie: „Da die strukturelle Macht prekär Beschäftigter und informell Arbeitender häufig begrenzt ist, bieten die Zentren [...] einen Ort, um die Form der Macht zu nutzen, die Beverly Silver als ‚Organisationsmacht’ bezeichnet hat“. Benz ist in ihrer Studie auf der Suche nach alternativen Machtressourcen und bemüht sich, diese zu finden, indem sie die Begrifflichkeiten der strukturellen und Organisationsmacht, die spezifisch auf eine Macht in der Rolle der Arbeitenden anspielen (also ökonomische Machtressourcen sind) mit politischen Machtkonzepten zu ergänzen. Öffentlichkeitsarbeit (Kampagnen) und Organisierung sind aber nicht lediglich Ergänzungen, sondern auch Ersatz für fehlende strukturelle Macht. Letztlich sind generieren die Worker Centers also eben durchaus eine Organisationsmacht wo aufgrund von Prekarität keine strukturelle Macht vorhanden ist.
Stellvertreter- oder Selbstorganisation? Auch diese Frage ist letztlich mit dem Forschungsmaterial nicht eindeutig zu beantworten bzw. ist eben beides richtig: Worker Center ist nicht gleich Working Center. Und oft genug stehen sich – gerade im US-amerikanischen Kontext – diese Begriffe auch nicht ausschließend gegenüber: „Advocacy“ hat einen ganz anderen Beiklang als die deutschsprachigen Begriffe „Stellvertreter“ oder „Repräsentation“: Es geht dabei eben durchaus nicht darum, stellvertretend für andere zu sprechen, sondern vielmehr darum, „Advokat“ für ein Interesse zu sein. Beide Ansprüche lassen sich durchaus gemeinsam denken und müssen da, wo es um die strukturelle wenig Mächtigen geht, auch gemeinsam gedacht werden.
Worker Centers in Deutschland?
Erstaunlicherweise stellt Martina Benz, wenn sie abschließend die deutschen Debatten um Organizing reflektiert, fest, dass das Thema Migration „weitaus weniger aufgegriffen“ würde. Für das gewerkschaftliche Organizing allgemein – oft eben nur eine Form der Mitgliedergewinnung – mag das bislang gelten, aber gerade, wo die Anwendungsmöglichkeiten von Worker Centers in Deutschland debattiert werden, steht die Migration im Fokus. Das ist auch kein Wunder: Etwas vereinfacht könnte man behaupten, dass im Allgemeinen das deutsche Gewerkschaftssystem im Vergleich zum US-amerikanischen System keine Worker Centers braucht: Die beschriebenen Aufgaben können allesamt gut und gerne von Gewerkschaften erfüllt werden. Trotzdem macht es, wie ja an einigen Stellen durchaus schon diskutiert und in der Praxis ausprobiert, Sinn für migrantische und prekär Beschäftigte über das Konzept nachzudenken: Dort zu sein, wo die Arbeitenden sind – oftmals eben nicht in der Fabrik, sondern in den Stadtvierteln, auf den Strassen, in den Cafés usw. – und aus gewerkschaftlichem Anspruch hinaus mit den Methoden der neuen sozialen Bewegungen zu arbeiten.
Titeldaten:
Benz, Martina: Zwischen Migration und Arbeit. Worker Centers und die Organisierung prekär und informell Beschäftigter in den USA. Münster, Verlag Westfälisches Dampfboot 2014. ISBN: 978-3-89691-956-4 272 Seiten Preis: 29,90 €.Zum Weiterlesen:
Einen Kurzbeitrag von Martina Benz „Die Organisierung von Niedriglohn-Beschäftigten in Worker Centers“ findet man im DGB-Online-Magazin Gegenblende.